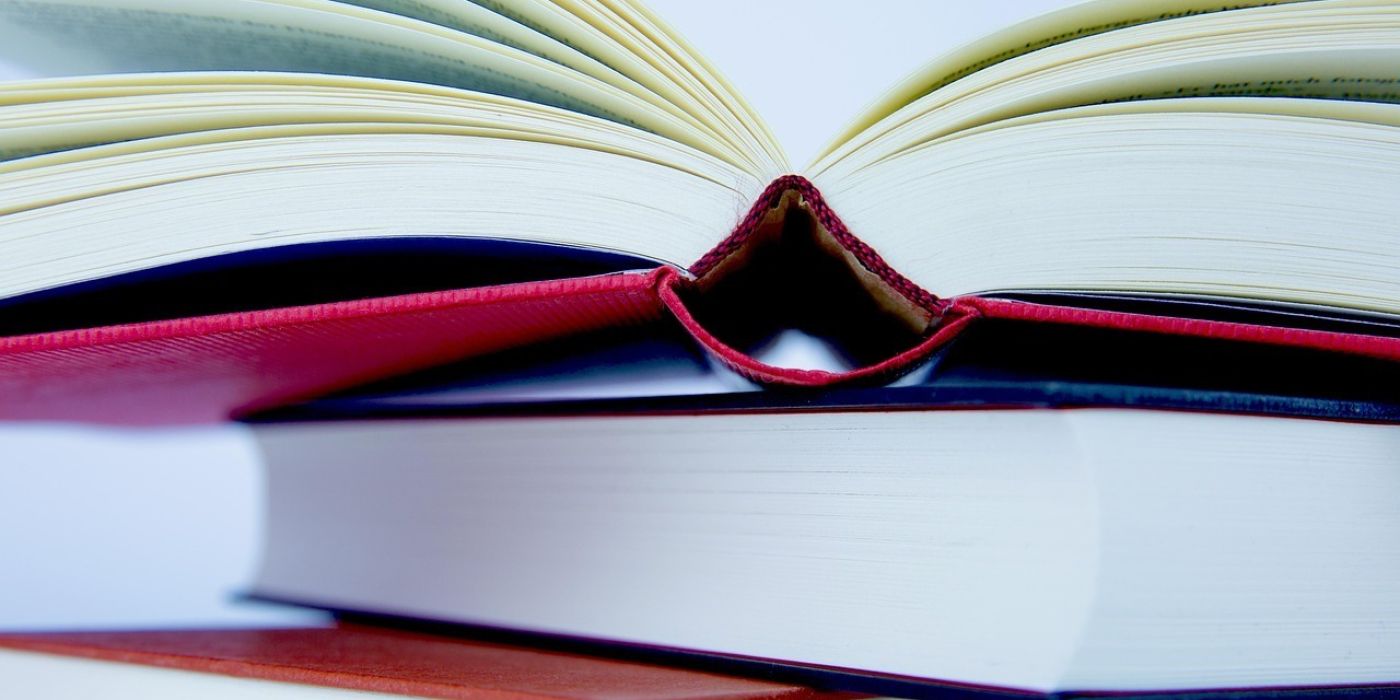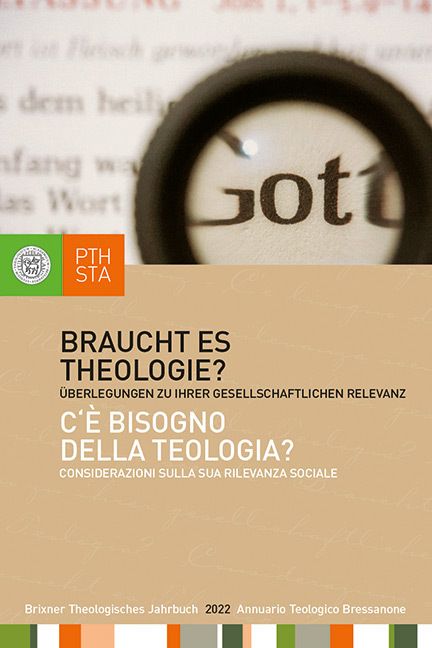
Braucht es Theologie? Cover: Tyrolia Verlag
Die titelgebende Fragestellung „Braucht es Theologie?“ wird in wunderbar regelmäßigen Abständen von unterschiedlichen Seiten mit je spezifischer Stoßrichtung, Akzentuierung und Motivation ins Wort gehoben. Während die einen die Notwendigkeit der Theologie, ihre Wissenschaftlichkeit, Objektivität und ganz allgemein ihren „Nutzen“ in Zweifel ziehen und sie so zu diskreditieren versuchen, sind die anderen tunlichst darauf bedacht eben diese aufzuzeigen, und so die eigene Existenz zu begründen und den Ruf als Orchideenfach zu widerlegen. In letzter Zeit lässt sich vermehrt die zweite Art von Abhandlungen über Wesen und Nutzen der Theologie, geschrieben von Theologinnen und Theologen, finden, die in fast apologetischer Weise ihr Fach und ihre Profession zu schützen suchen. Wer will es ihnen auch verübeln, bei einer oft verschwindend(en) geringen Zahl an Studierenden, der ständigen Bedrohung durch „notwendige“ Einsparungen und in einem schier unmenschlichen Wettbewerb um Drittmittel?
Nun widmet sich auch das Professorium der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen in einem Jahrbuch dieser komplexen Fragestellung. Es setzt hierbei den Akzent vor allem auf die gesellschaftliche Relevanz des Faches. Die vorgelegten Beiträge befassen sich mehr oder weniger direkt mit diesem brisanten Thema.
Prof. Dr. Christoph J. Amor zeigt in seinem Beitrag „Totgesagte leben länger“ auf schonungslose Weise die Entwicklung der Theologie an der Universität auf – von der Hybris der Selbsteinschätzung als „Königin unter den Wissenschaften“ an der mittelalterlichen Universität, über die vielfachen Anfragen an ihre Wissenschaftlichkeit im Zuge und im Windschatten der Aufklärung, bis zum heutigen Plausibilitätsverlust des christlichen Glaubens und dem (auch) damit einhergehenden Einbruch der Studierendenzahl. Trotz der unverblümt geschilderten ernsten Situation plädiert er für die „Glaubensvergewisserung“ und besonders den „Weltdienst“, welche universitäre Theologie leisten kann. Sein Fazit: Theologie ist ein kostbarer Luxus, den eine Gesellschaft sich leisten sollte.
„Die gesellschaftliche Relevanz der Theologie auf dem Prüfstand“ überschreibt Prof. Dr. Markus Moling seinen Artikel und problematisiert die Bewertung der Relevanz von Wissenschaften. Unter Rückgriff auf unterschiedliche Relevanzverständnisse zeigt er den starken Legitimationsdruck, aber auch die Ambivalenz dieses Drucks für verschiedene Disziplinen auf. So ist bereits die Auswahl des Relevanzbegriffs und der zugehörigen Methode ausschlaggebend für das Ergebnis der Bewertung. Die Bevorzugung eines bestimmten Bewertungsmodus führt so zur Bevorzugung bestimmter Wissenschaften und schränkt sowohl die Vielfalt von Wissenschaften als auch ihre Freiheit ein. Der Frage, wie beiden Problemen zu begegnen ist, widmet Moling ein umfassendes Kapitel und geht dabei auch auf den – häufig problematisierten – Zusammenhang von Lehramt und Theologie bzw. Lehramt, Theologie und Gesellschaft ein. Abschließend plädiert er für eine Theologie als „Sauerteig“ der Gesellschaft, deren Relevanz nicht rein ergebnisorientiert erfasst werden könne, die die großen Sinnfragen des Menschen offenhalten solle und die u.a. auch in der Nähe zur Kirche und in der Ausbildung kirchlichen Personals gesellschaftlich relevant ist.
Die Zukunft der Theologie an staatlichen Universitäten untersucht Prof. Dr. Josef Quitterer. Dabei spielt die bekannte These, Theologie könne, im Unterschied zur Religionswissenschaft, aufgrund ihrer Grundlage in einem persönlichen Bekenntnis – einem Für-wahr-halten zentraler Inhalte – keine objektive Wissenschaft sein, eine zentrale Rolle. Quitterer zeigt hingegen auf, dass „gerade der Bekenntnischarakter der Theologie ihre Wissenschaftlichkeit ermöglicht“ (S. 166). Hierfür bemüht er den Vergleich des Behauptens von wahren Sätzen in den Naturwissenschaften und in der Theologie. Das Vertreten religiöser Überzeugungen im theologischen Diskurs mache diese verwundbar und sei insofern etwas deutlich anderes als das bloß religionswissenschaftliche Verständnis dieser Überzeugungen. Theologie könne folglich nicht einfach durch Religionswissenschaft ersetzt werden, denn sie biete einen Erkenntnisgewinn und trage zur „Verbesserung der Qualität von weltanschaulichen und religiösen Glaubenssystemen bei“ (S. 173).
Während diese drei Beiträge sehr explizit das Thema des Sammelbandes behandeln, beschäftigen sich die weiteren Artikel v.a. mit theologischen Themen, welche für die vorgegebene Fragestellung jedoch nicht von geringer Bedeutung sind. Hier eine Auswahl:
So widmet Prof. Dr. Ludger Jansen seine Überlegungen der schwierigen Verhältnisbestimmung von Theologie und Philosophie. Durch eine differenzierte Begriffsbestimmung von „Theologie“ und „Philosophie“ lässt sich ein je unterschiedliches Verhältnis beider zueinander skizzieren. Entgegen einem lange vertretenen Stockwerk-Modell des Verhältnisses plädiert Jansen für ein kooperatives Verhältnis von Theologie und Philosophie, in dem letztere ihre Kompetenz als Wissensprüfung einbringt. Unter dieser Prämisse kann auch der interdisziplinäre Dialog einen anderen Akzent erhalten.
Prof. Dr. Martin M. Lintner bedenkt die Spannung zwischen „Kirchlichkeit und kritischer Öffentlichkeit“, in der die Moraltheologie steht. Nur durch die redliche Offenlegung der kirchlichen Voraussetzungen könne Moraltheologie vor den kritischen Anfragen der Öffentlichkeit bestehen. Ebenso wie sie sich ihres Anspruchs bewusst sein muss, ihre Positionen vernünftig nachvollziehbar in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Vor der Herausforderung, in dieser Spannung zu bestehen, sieht sich der Moraltheologe.
Dass gesellschaftlich aktuelle Themen, wie Genderstudien oder Men’s studies auch für die Theologie von Relevanz sind, zeigt Prof. Dr. Maria T. Ploner. Vor dem Hintergrund kurz skizzierter Männlichkeitskonzepte und -diskurse öffnet sie das weite Feld der Erforschung von Männlichkeit in der Exegese und zeigt erste Ansätze und Forschungsfelder anhand von Beispielen auf. Hier kann theologische Forschung einen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion eines relevanten Themas beitragen.
Insgesamt gibt der Sammelband gute Impulse, um die Frage „Braucht es Theologie?“ zu bedenken. Den Herausgebern ist es gelungen, die gesellschaftliche Relevanz der Theologie durch die unterschiedlichen Perspektiven explizit oder auch implizit aufzuzeigen und so einen beachtenswerten Beitrag zur Diskussion um die Rolle der Theologie heute zu leisten.

Martin Grimm ist Studienleiter bei Theologie im Fernkurs.