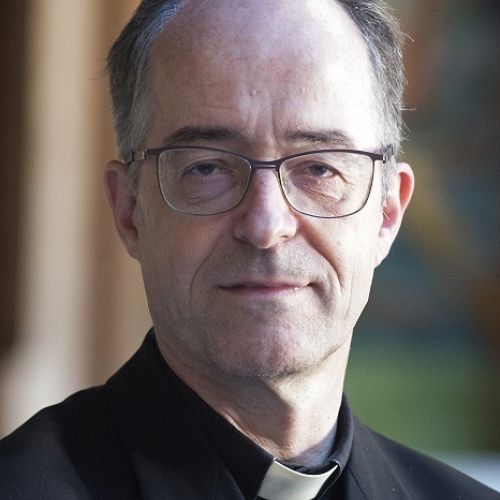Über Jahrhunderte hinweg haben sich die Menschen auf den weiten Weg nach Rom um der „vollkommenen Vergebung“ willen gemacht. Stehen heute Sightseeing und Selfies ganz im Zentrum, so machte man sich damals auf, um so viel Vergebung wie möglich in den Kirchen Roms zu gewinnen. Der Pilger vor der Renaissance hatten keinerlei Augen für Kunst und Schönheit, sondern nur für Reliquien, Heiltümer und Wunderkammern. Das wissen wir alles aus den „Ablassbüchern“ des 13. bis 15. Jahrhunderts, die den Pilgern als Stadtführer dienten.
Bereits im Barock treten an deren Stelle handliche „Kulturführer“, immer noch fromme Büchlein zu den Wunderkammern der Kirchen Roms, aber nun auch mit der Beschreibung des Kirchenraums, der Mosaiken, Malereien und sonstigen Kunstwerke.
Der Mönch Martin Luther hat dies alles nicht kritisiert. Er hat bei seinem Romaufenthalt 1511/12 selber die Vergebungen in vielen Kirchen Roms gewonnen. Was Luther hingegen angesichts seines starken Sündenbewusstseins abgelehnt hat, war die Entkoppelung der Vergebung von den Bußwerken (Fasten, Wallfahrt, gute Werke), also Ablässe, die man einfach kaufen konnte. Das waren in der Tat Missbräuche, die es vor allem in seiner deutschen Heimat gab.
Aufhänger der späteren Ablasskritik der Reformatoren ist der Neubau von Sankt Peter, der 1506 beginnt. Um dieses Riesenbauwerk zu finanzieren, muss der Ablass in ganz Europa dafür herhalten, möglichst viel Geld zu gewinnen. Dabei ist natürlich die Geldspende als Buße eine völlig normale Angelegenheit seit der Zeit der Apostel. Was hier störte, war die totale Kommerzialisierung der Gnade. Die Kirche sah sich als Monopolistin der Gnade, die die Preise gestalten konnte, wie sie wollte. Natürlich waren das krasse Fehlentwicklungen, aber die sind dann doch – Gott sei Dank – überwunden.